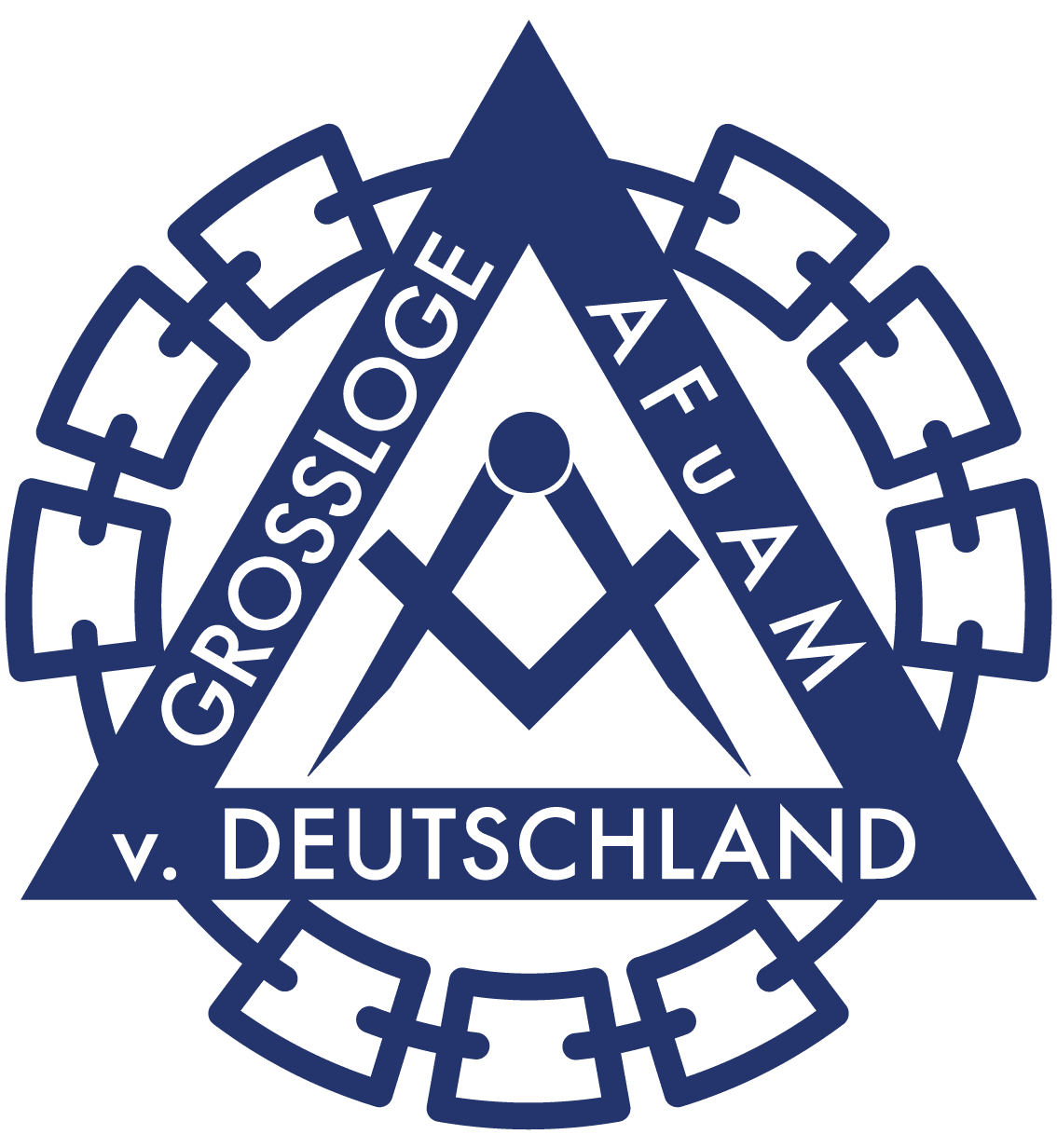"Im Paradies braucht es Jahre, bis tiefe Freundschaften wachsen. In der Hölle geht das schneller", vermerkt der Journalist Dirk Planert in seinem Tagebuch. Und dann verteilt er die Spenden seiner Loge "Zur Alten Linde".
Von Br. Dirk Planert
Den ersten Termin habe ich beim Direktor des Stadtarchives. Eine Korrespondentin der ARD ist dabei. Ihr Studio in Wien will eine Geschichte machen; über den humanitären Helfer, der nach 25 Jahren zurückkehrt. Eldina heißt sie und hat Sarajevo erlebt. Das ist praktisch. Sie weiß Bescheid. Auch ein Kameramann des örtlichen Fernsehens und eine Redakteurin sind dabei. Der Direktor freut sich sehr und erklärt mir, dass es das noch nie gegeben habe, dass jemand Material für das Archiv bringe und kein Geld dafür haben wolle. Ich greife in die Hosentasche, nehme die Sticks mit meinem Archiv heraus und reiche sie ihm in die Hände. In mir wird es sofort leichter. Als würde ich etwas weggeben, loslassen, loswerden. Es fühlt sich gut an, sehr gut sogar. „Lass uns eine Fotoausstellung mit Deinen Bildern machen“, sagt er begeistert. „Nein“, antworte ich. „Auf keinen Fall. Ich will nicht, dass Menschen sich das ansehen und mit schweren Herzen nach Hause gehen. Ich habe eine andere Idee. Ich mache jetzt das zweite Foto. Ich suche die Menschen, die ich auf Bildern habe und fotografiere sie noch mal. Es liegen genau 25 Jahre dazwischen. Wir können einen Teil ihrer Geschichte mit zwei Bildern erzählen. Dem alten Foto und dem neuen.“ Jetzt ist der Direktor noch mehr begeistert und wir schlagen ein. Deal! Im Sommer soll die Ausstellung stattfinden.
“Plötzlich bin ich selbst die Geschichte. Es geht nicht um mich.
Es geht um Liebe, Menschlichkeit, Brüderlichkeit.”
Ohne dass ich das vorher wusste, habe ich im Anschluss einen Termin beim Bürgermeister. Das haben wohl die Journalistenkollegen organisiert. Eigentlich wollte ich hier in Ruhe meine Hilfsgüter verteilen und die Situation mit den vielen Flüchtlingen recherchieren. Plötzlich bin ich selbst die Geschichte. Es hat sich auch unter den hiesigen Journalisten herumgesprochen, dass ein ehemaliger Humanitärer Helfer zurückgekommen ist. Ein Radiokollege interviewt mich. Nach einer Weile wird mir das alles zu bunt und ich erkläre ihm mit einem „Feuer“ das mich an früher erinnert: „Es geht nicht um mich. Es geht um die Idee, die damals dahinterstand und das bis heute tut. Es geht um Liebe, Menschlichkeit, Brüderlichkeit. Es geht darum füreinander da zu sein, wenn es notwendig ist. Es geht darum, sich nicht auf die Politik zu verlassen, sondern selbst etwas zu tun. Ganz einfach, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Das kann jeder in seinem direkten Lebensumfeld. Dafür muss man nicht in einen Krieg fahren“. Nach dem Interview tippt mir die Redakteurin des Lokalfernsehens auf die Schulter und sagt: „Ich habe einen kleinen Beitrag für heute Abend geplant. Ich habe Dir gerade zugehört. Wir müssen das größer machen. Ich möchte gern, das Dich mein Mann, unser Kameramann Muhamed, so oft es geht begleitet, während Du hier bist. Ich will eine Doku über Dich machen, die dann im bosnischen Fernsehen läuft“. „Ich bin’s doch nur, macht doch nicht so ein Theater“, antworte ich. „Doch, ich will, dass die Menschen hören was Du sagst“, erwidert sie. Ich denke mir: „Na gut, in einem Land, in dem es noch immer eine Menge Hass gibt, von Liebe, Zusammenhalt und Menschlichkeit zu sprechen, das kann nicht falsch sein.“ Außerdem spielt es mir in die Karten. Je besser mein Standing in der Stadt ist, desto leichter lassen sich Dinge bewegen. Arbeitsplätze sind notwendig, Mehr als die Hälfte der Menschen haben keinen Job, deshalb verlassen die Jungen die Region. Wenn es so weitergeht, ist Bihac in fünf Jahren ein Altenheim. Vielleicht lässt sich das ändern? Am Abend läuft der erste Beitrag im lokalen Fernsehen und ich poste Bilder bei Facebook, um die Menschen darauf zu finden. Das funktioniert. Sehr schnell sogar. Die Bosnier sind facebooksüchtig, es wird geteilt, was das Zeug hält. Am nächsten Tag sitze ich vor Sabina Arzic. Bis gestern wusste ich ihren Namen nicht. Ich habe sie damals im Krankenhaus fotografiert, als sie gerade ihr Bein verloren hatte.

Sie war vor dem Haus und wusch die Windeln ihres neugeborenen ersten Sohnes, als die Granate kam. Heute hat sie drei Kinder, ein Enkelkind und eine Prothese. Sie ist schüchtern, aber ihr Lächeln ist ein Geschenk. Ich habe sie nicht vergessen, ab und an habe ich an sie gedacht. Sie jetzt so zu sehen, das ist für mich wie ein Wunder

Ab jetzt passiert so etwas mehrmals am Tag. Ich habe fürchterliche Zahnschmerzen, schon seit einigen Tagen. Auf dem Weg zum Zahnarzt höre ich, wie Passanten in der Innenstadt tuscheln: „Das ist er!“ Merkwürdig ist das. Mit dem Hund an der Seite werde ich leicht erkannt. Meine Gefährtin Sam war ja auch im Fernsehen. Ab und an kommen wildfremde Passanten auf mich zu, reichen mir die Hand und die Gespräche beginnen fast alle mit: „Danke für das, was Du für uns getan hast“. Es dauert ein wenig, zum Zahnarzt zu kommen. Als mir der „Direktor des privaten Kriegsmuseums“ über den Weg läuft und er hört, dass es meinen alten Stahlhelm noch gibt, will er ihn für sein Museum haben. So lange ist das schon her? Museumsreif!
„Hier vergeht das Leben so schnell wie der Rauch einer Zigarette“
Eine halbe Stunde später sind zwei Zähne raus. Jetzt liegen mehr davon in einer Schachtel in meiner Wohnung in Dortmund als ich noch im Original im Mund habe. Vielleicht habe ich mir doch ein wenig zu oft „auf die Zähne“ gebissen.
Mit der ARD-Journalistin treffe ich mich in einem Café. Sie braucht ein paar kleine Geschichten aus der Zeit damals. Ich schlage ihr vor, zu einem der Häuser zu fahren, in dem ich dachte, dass ich jetzt sterben werde. Ein paar Minuten später stehe ich auf einem 40 mal 40 Zentimeter großen Stück Teer, einem Flicken für ein Loch in einer Straße. Kurz nachdem mein Freund und Übersetzer Abdullah Kadic damals diesen Satz sagte: „Hier vergeht das Leben, so schnell wie der Rauch einer Zigarette“, war an dieser Stelle eine von mehreren Panzergranaten eingeschlagen. Wir saßen damals nur ein paar Meter entfernt in einer Wohnung. Sie hält mir das Mikro vor das Gesicht, ich erzähle und währenddessen fühlt es sich an, als hätte mir etwas oder jemand den Rest meines Lebens geschenkt. Ich stehe die ganze Zeit auf dem Teerflicken. Ohne dieses Geschenk wäre ich jetzt schon 25 Jahre tot. Schön ist das. Glück gehabt. Tatsächlich. Leben oder Sterben, das war nur eine Frage von Glück oder Pech. Man wusste nie, wo die nächste Granate einschlägt.

Nach ein paar Tagen Interviews und Arbeiten an den „zweiten Fotos“ werde ich langsam unruhig. Als „verlängerter Arm“ der “Alten Linde” habe ich ja noch etwas zu tun. Die Hilfsgüter verteilen und das Geld sinnvoll ausgeben.
Doch vorher steht noch etwas Anderes an. Eldina von der ARD und der Kameramann Muhammed haben mich gebeten, dabei sein zu dürfen, wenn ich die Kinderabteilung des Krankenhauses besuche. Ich will das und habe gleichzeitig Angst davor. Hier hat sich damals alles Schreckliche verdichtet. Niemals davor oder danach habe ich etwas Schlimmeres gesehen, als eine Kinderstation während einer Offensive. Ich habe keine Ahnung, was mit mir passieren wird — und dann noch die Kameras der Journalisten? Damals habe ich mir geschworen, mich für meine Tränen niemals zu schämen. Dann sollte das, was viele Jahre galt, auch jetzt so sein. Wir fahren durch die Stadt zum Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin tauchen Bilder auf: Das Funkgerät und Dieters Stimme: „Go, gib Gas, Mann!“ Dann Krankenschwestern, die hektisch unsere Hilfsgüter ausladen, ein junger Soldat mit Kopfschuss in der Leichenhalle des Krankenhauses, dessen Gehirn offen liegt, ein kleines Mädchen schreiend und schwerstverletzt.

Das geht alles blitzschnell und die Bilder vermischen sich mit Gerüchen, Geräuschen und erzeugen ein Gefühl. Das lässt sich mit einem Wort beschreiben: Schmerz. Ich meine den Schmerz, den der Krieg hinterlässt, wenn er vorbei ist. Das tut so weh, das der Körper reagiert. Der Magen zieht sich zusammen, der Hals schwillt zu, Wasser bildet sich in den Augen, die Körperhaltung verändert sich. Mein Atem wird schneller, viel zu schnell.
Ich muss runterkommen, raus aus diesem Strudel und im jetzt sein. Jetzt will ich funktionieren. Außerdem muss ich da durch, wegen der Reparatur und dem Enkelkind, das noch nicht geboren ist. Ich verdränge die alten Bilder und hole kurz das des Tempels der „Alten Linde“ in mir hervor. Ich höre den Meister vom Stuhl am Ende des Rituals sagen: „Und nun geht hinaus in die Welt und bewährt Euch als Freimaurer…“. Was das ist, diese Bewährung, das muss jeder für sich selbst wissen. Für mich ist es jetzt: ruhig atmen, grade stehen und nur in diesem Augenblick sein. Ich will diese Chance nutzen. Es hat lange genug gedauert, bis die Zeit gekommen war, hierhin zurück zu kehren.
Ich öffne die Tür zum Treppenhaus. Das muss ich drei Mal machen, wegen des Kameramanns. Er braucht die Bilder. „Journalisten können einem ganz schön auf die Nerven gehen“, sage ich zu Muhammed. Wir lachen beide. Ich bin selbst Radio- und Fernsehjournalist. Er weiß das, deshalb kann ich das sagen, ohne unhöflich zu sein. Eine Etage hoch und da ist sie: die Kinderstation des Krankenhauses Bihac. Ein gottloser Ort, damals. Als ich das erlebt habe, stellte sich kurz die Frage: „Wo ist Gott?“ Die Antwort lag vor mir: „Hier jedenfalls nicht“. In meinen Tagebuchaufzeichnungen steht: „Allah, warum hast Du diese Stadt verlassen?“. Die Tür ist abgeschlossen und wir klingeln. Eine Schwester kommt. Ich kenne sie nicht. Sie lässt uns nicht rein. Großartig! Das ist Normalität. Diese Frauen sind einfach fantastisch, immer noch. Was hat ein Fremder in der Kinderabteilung eines Krankenhauses zu suchen? Nichts! Wir verschieben den Besuch auf den nächsten Tag. Dann habe ich sowieso einen Termin mit dem Direktor.
Am Abend sitze ich mit Alisa in der Küche. Ich wusste gar nicht, dass wir im gleichen Alter sind. Als sie damals aus Dieters Versteck in dem gelben Post Lkw kletterte, waren wir 26. Jetzt sind wir 51. Das nicht zu wissen, ist symptomatisch. Wir haben damals nur im hier und jetzt gelebt. Es gab keine Vergangenheit, für die Zukunft nur den Traum vom Frieden und die Hoffnung, dass wir alle überleben. Nach dem Krieg hatte ich sogar vieles vergessen. Kindheit, Jugend und das Studentenleben waren verschwommen. Das kam erst viele Jahre später alles zurück. Alisa sagt an diesem Abend zu mir: „Das wirst Du nicht glauben, wir haben seit über zehn Jahren nicht darüber gesprochen. Du bist der einzige, der noch so oft an den Krieg denkt“. „Das ist doch logisch“, erwidere ich. „Ihr seid hier, ihr habt gesehen, dass neue Kinder geboren werden, neue Häuser gebaut wurden, Bäume wachsen, sich alles verändert. Ich habe all das nicht gesehen. Ich habe noch die alten Bilder im Kopf.

Wenn ich zurückfahre, werde ich neue Bilder haben. Von den selben Menschen oder den selben Orten, die auf den alten Bildern zu sehen sind. Auf meiner Festplatte im Computer und in meinem Kopf. Das ist der Plan.

Mal sehen, ob es funktioniert. Immerhin habe ich keine Albträume mehr, seit ich hier bin. Das ist doch ein gutes Zeichen. Alisa versteht das. Jeder hier versteht das. Hier machen diese Erfahrungen nicht einsam. Hier haben sie zusammengeschweißt. Diese Naht hat gehalten. Eines „meiner Kinder“ von damals, heute selbst Mutter von zwei Kindern, hat vor ein paar Tagen in einem Interview mit der ARD-Journalistin gesagt: „Mi smo Prijatel do kraja zivota“. „Wir sind Freunde, bis zum Ende des Lebens.“ Im Paradies braucht es Jahre, bis tiefe Freundschaften wachsen. In der Hölle geht das schneller.
Am nächsten Morgen stehen die ARD-Journalistin Eldina, Kameramann Muhammed und ich wieder vor der Tür der Kinderabteilung. Dieses Mal hat uns der Direktor angemeldet und wir dürfen rein. Es riecht nach Babyöl. Der bittere Geruch von Schweiß und der süßliche von Blut und Tod sind verschwunden. Die Wände sind hell gestrichen. Bunte Kinderbilder hängen an den Wänden. Die Betten sind sauber und sogar ohne Rost. Durch das Fenster kommt Licht herein, weil keine Holzbalken mehr davorstehen. Ich mache Fotos von einer jungen Mutter mit ihrem Kind im Arm. Als ich das in diesem Raum schon einmal gemacht habe, hat hier niemand gelächelt.

Jetzt ist das anders.

Ich bekomme schon wieder Wasser in den Augen. Im Flur stehen die Schwestern und zeigen sich gegenseitig ein Bild von damals, das eine bosnische Zeitung vor kurzem gedruckt hat. Es zeigt mich mit einem behinderten Kind auf dem Arm. Jasmin Zahid Alicic hieß der Kleine. Ich habe ihn oft im Arm gehabt. Jedes Mal wenn ich hier war. Die Schwestern hatten dafür meist keine Zeit. Seine Eltern hatten ihn, vermutlich wegen der Hirnschädigung, einfach im Krankenhaus liegen lassen und sind gegangen.

Die Journalisten sprechen mit den Schwestern, ich gehe langsam von einem Raum zum anderen und sehe durch die kleinen DIN-A4-Blatt-großen Fenster in den Türen kurz hinein. Im letzten Zimmer rechts, mit Jasmin auf dem Arm, hatte ich zum ersten Mal eine Ahnung von dem, was das griechische Wort Agape bedeutet. „Bedingungslose Liebe“ soll eine unzureichende Übersetzung sein. Das Licht kommt aus der Dunkelheit. Da ist was dran.
Wir verabschieden uns und beim Hinuntergehen auf den Treppenstufen sind meine Knie so weich, das ich aufpassen muss nicht hinzufallen. Nicht weil es unerträglich wurde. Ganz im Gegenteil. Jetzt kann ich es besser tragen. Ich bin nicht einfach erleichtert. Ich habe Tonnen an Gewicht verloren, jetzt gerade, in diesen paar Minuten. Ich habe sie dort gelassen. Ich muss an Friedrich Nietzsche denken: „Jetzt bin ich leicht, jetzt fliege ich…“.
Nun wird es Zeit, das zu verteilen, was mir die Brüder mitgegeben haben. Ganz so einfach ist das nicht. Mittlerweile weiß ich, das etwa 2500 Flüchtlinge in einer Fabrikhalle untergebracht sind. Die IOM (Internationale Organisation für Migration) hat die Halle gemietet. Darin sollen Container und Zelte stehen. Ich kann mich schlecht davorstellen und den Kofferraum aufmachen. Chaos und Probleme brauche ich nicht. Bürgermeister Surhed Fazlic hatte mir erzählt, dass er ein humanitäres Desaster befürchte, wenn der Winter ende und wieder Bewegung in die Flüchtlingsrouten komme. Kaum ein Flüchtling kann Bihac verlassen. Seine Befürchtung ist, dass Tausende dazu kommen. Die EU schicke Geld für die Flüchtlinge nach Sarajevo, sagt er. „Aber in Bihac kommt davon kein Cent an“. Als im vergangenen Sommer plötzlich mehrere tausend Menschen in Bihac ankamen, bildeten sich lokale Initiativen, die deren Versorgung managten. Mittlerweile sind einige große Organisationen hier, die das übernommen haben. Die Hilfsindustrie hat hier Arbeit gefunden. Das Frühstück der heutigen Flüchtlinge sieht noch genauso aus wie damals, im Transit Camp in Karlovac. Eine Scheibe Brot, ein Hauch Butter und ein Löffel Marmelade. Auf den Straßen sieht man viele junge Männer mit Rucksack. In der Innenstadt halten sie aber nur wenige auf. Die Polizei schickt sie zurück in die Lager. Frauen und Kinder sind in zwei Hotels untergebracht. Auch in Velika Kladusa, einem Ort nördlich von Bihac, sollen viele sein. Es sind Menschen aus Afghanistan, Pakistan, dem Irak und Afrika. Seit Anfang vergangenen Jahres werden diese Menschen auf ihren Wegen durch die Balkanstaaten nach Bosnien geschickt und Sarajevo leitet sie weiter nach Bihac. Manchmal kommen ganze Züge aus Sarajevo an.
Die ARD-Journalistin Eldina Jasarevic hatte mir von einer Frau erzählt, die als Privatinitiative Flüchtlingen hilft. Ich verabrede mich mit ihr und sage am Telefon nur, das ich Journalist bin, nicht dass ich Geld dabeihabe. Es erscheint mir am Vernünftigsten, gewachsene lokale Strukturen und deren Erfahrung zu nutzen und nicht blauäugig irgendwo den Kofferraum zu öffnen. Die zehn Schlafsäcke hat Husnija bereits verteilt. Er kennt einige Flüchtlinge von der Straße vor seinem Haus. Obwohl er nur eine Hungerrente hat, gibt er, was er geben kann. Auch daran hat sich nichts geändert.
Die Frau heißt Zemira Gorinjac, ihre Privatinitiative „Udruzenje gradana Solidarnost“, also Bürgervereinigung Solidarität. Als ich an ihrem Haus ankomme, steht die Garage offen. Auf dem Boden stehen Pappkartons. Sie sind zu einem Drittel gefüllt mit Reis, Nudeln und Dosenfisch. Zemira Gorinjac packt Lebensmittel in Plastiktüten. Viel ist es nicht, was sie in den Kisten hat.

Ihr Volontär Rasim, ein Flüchtling aus Pakistan, steht vor der Garage und telefoniert: „In fünf Minuten am Supermarkt. Sag den anderen Bescheid“. Rasim ist vor Sprengstoffanschlägen in seiner Heimat geflohen. „Ich wollte nicht sterben“, sagt er. Jetzt hängt er seit sechs Monaten in Bihac fest. „Mama, wir können los“, ruft er und meint Zemira Gorinjac. Alle Flüchtlinge nennen sie so. Wir laden auch in meinen Wagen ein paar Plastiktüten und fahren los.
Drei Minuten später halten wir vor einem Einkaufszentrum. „Mama“ fährt nicht zu der Fabrikhalle, um ihre Hilfsgüter zu verteilen. Das gäbe Ärger mit dem IOM, der Polizei und all jenen, die nichts bekommen. Deshalb lässt sie Rasim telefonieren und er lotst dann kleine Gruppen an wechselnde Orte. Aus der einbrechenden Dunkelheit kommen etwa 20 Männer.

Einige haben blaue Flecken im Gesicht, dünne Kleidung hält sie nicht warm genug. Wieder sind es „geschundene Gestalten“.

Ein etwa 18jähriger zeigt „Mama“ stolz ein Loch zwischen seinen Zähnen. Gestern wurde ein Zahn gezogen. Er hatte Schmerzen, „Mama“ hat den Arzt bezahlt. Drei Schwarzafrikaner stehen am Rand. Sie erzählen, dass sie „the game“ über zehn Mal versucht haben. Gemeint ist der Versuch, über die Grenze in die EU zu gelangen. Der Weg führt durch die Wälder, vorbei oder mitten durch Minenfelder, wer weiß das schon.

Sie kennen sich hier nicht aus. Es ist ein Spiel. Mit der kroatischen Polizei und mit dem Leben. „Wir hatten es nach Kroatien geschafft“, sagt einer. „Dann sind sie gekommen und haben uns mit ihren Knüppeln verprügelt. Überall hatte ich blaue Flecken und Schmerzen. Dann haben sie unsere Smartphones zerschlagen. Sie wissen, dass wir die für unsere Navigation brauchen. Wir mussten unsere Schuhe ausziehen und wegwerfen. Dann haben sie uns nach Bosnien zurückgetrieben wie Vieh“. Emmanuel ist vor zwei Jahren vor dem Krieg in Nigeria geflohen. „Ich hatte keine Wahl, glaubst Du ich würde hier sitzen, wenn ich eine gehabt hätte? Hier will ich auch nicht sein. Ich will nach Deutschland, oder Italien. Ich will leben, ich will arbeiten. Ich will mich wieder als Mensch fühlen.“